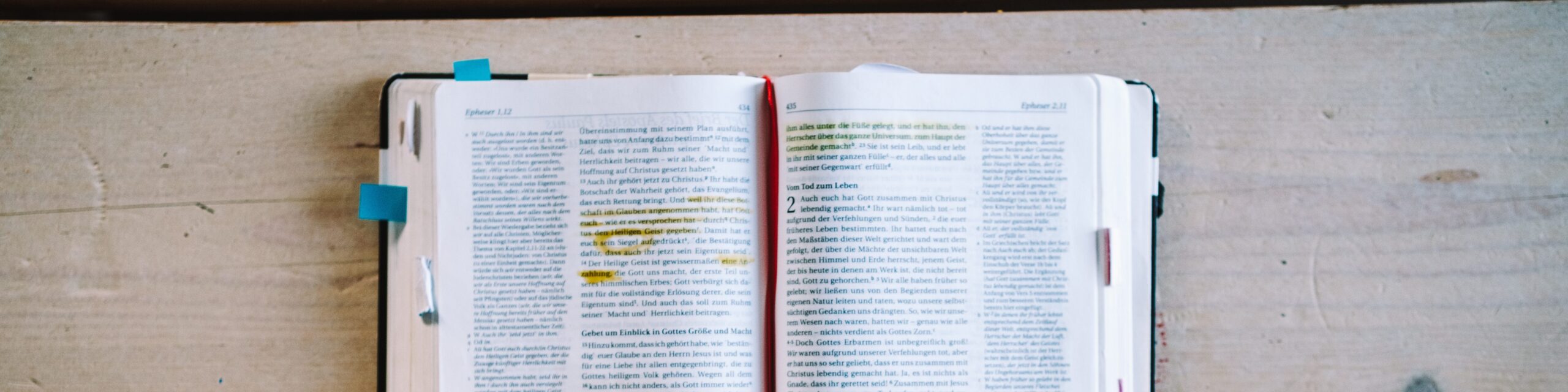Lectio divina stammt aus dem Frühen Mönchtum. Sie ist eine Form des betrachtenden Bibellesens. In ihrer klassischen Form gliedert sie sich in vier Schritte: Lesen – Bedenken – mit Gott darüber ins Gespräch kommen – Stille vor Gott sein.
Die Methode
1. Lesen und Wahrnehmen
Um einen Text zu verstehen, ist es wichtig ihn zuerst zu lesen und in seinen Eigenschaften wahrzunehmen. Der Text wird langsam gelesen, die Textart und der Zusammenhang, in der der Abschnitt steht, werden wahrgenommen.
2. Bedenken
Der Text wird analysiert: welche Personen kommen vor? Wie sind die Bewegungen im Text. Was für Haltungen könnten hinter dem jeweiligen Handeln stehen? Gibt es Parallelstellen? Wie wird diese Stelle in anderen Bibelausgaben übersetzt? Welche Informationen zur besseren Einordnung des Textes in die Kultur der Zeit stehen mir zur Verfügung? Es kann auch ein Bibelkommentar zu Rate gezogen werden.
3. Mit Gott darüber ins Gespräch kommen
Man könnte diesen Schritt auch „der Text liest mich“ nennen. Was bewegt der Text in mir, was für Bilder, Assoziationen, Gedanken weckt er? Ich komme darüber mit Gott ins Gespräch. Aus diesem Schritt entwickelt sich der nächste:
4. Stille werden vor Gott
Aus dem Sprechen ins Hören kommen. Stille vor Gott bedeutet nicht nur schweigen, sondern hören, vielleicht auch gemeinsam schweigen, damit das der gelesene und betrachtete Text in dieser Stille einen Resonanzraum erhält.
Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite des katholischen Bibelwerks Stuttgart.